Das Wissen der digitalen Literatur
Digitale Literatur – Literatur, die wesentlich mit und durch Computer entsteht – hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Dynamik entwickelt. Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, Natural Language Processing und soziale Medien haben das Feld nachhaltig erweitert. Das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderte Netzwerk aus Wissenschaftler*innen und Autor*innen untersucht die hier entstehenden zeitgenössischen epistemischen, hermeneutischen und didaktischen Potenziale.
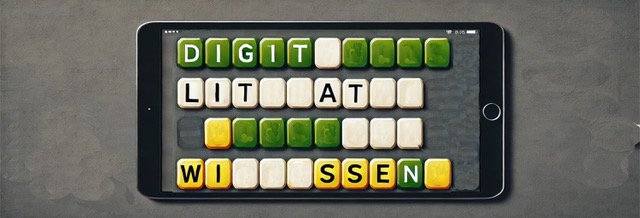
Im Mittelpunkt steht die These, dass genuin digitale Literatur diskursive, praxeologische und technische Aspekte des Schreibens im digitalen Raum in besonderer Weise verknüpft. Ihre Produktionsform ähnelt dabei nicht von ungefähr wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden der Digital Humanities, der Medienarchäologie oder der KI-Forschung. Noch vor ihrer sekundären wissenschaftlichen Analyse ist sie hier selbst unmittelbar an der Produktion von Wissen beteiligt. Aber auch als genuin ästhetische Praxis ist ihr ein spezifisches Wissen über Text, Materialität, Medialität und Performanz im Digitalen zu eigen.
Das Netzwerk untersucht diese Konstellationen des Wissens digitaler Literatur mit einem multidisziplinären Zugang, der künstlerische Praxis und Theoriebildung eng miteinander verzahnt. Beteiligt sind, neben zahlreichen Akteur:innen des Feldes, Vertreter:innen von Literatur- und Medienwissenschaft, Digital Humanities, Critical Code Studies, Design Studies, Linguistik, Interface Studies, Künstlicher Intelligenz, Wissenschaftsforschung, Informatik und Philosophie.
Das Netzwerk startete im Dezember 2024 und läuft 3 Jahre. Es wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.
Kontakt:
Prof. Dr. Annette Gilbert, FAU Erlangen-Nürnberg, Dept. Germanistik & Komparatistik, Bismarckstr. 1, 91054 Erlangen, annette.gilbert@fau.de
Termine sowie vergangene Veranstaltungen und Informationen dazu findet Ihr hier:
Termin #1: Kick-off-Treffen
Virtuelles Kick-off-Treffen am 24./25.03.2025
mit Vorträgen von Scott Rettberg:
»From Minimalism to Maximalism: How Algorithmic Narratives are Driven by Dispersal and Reconnection«
und Lillian-Yvonne Bertram: »Computers Killed the Creative Writing Star«
Termin #2: Workshop
»System.loadLibrary(): Epistemologische Affordanzen digitaler Literatur«
Ruhr-Universität Bochum, 26.-27.06.2025
Formen digitaler Literatur entstehen in Auseinandersetzung mit ihren Techniken und Praktiken: Hardware-Voraussetzungen, Algorithmen, Programmierverfahren, Datenbanken oder Interaktionsdesigns. Sie sind dabei – ganz wie das Wissen im modularisierten Format einer Programmbibliothek – Teil einer Operationskette und besitzen, um mit Caroline Levine zu sprechen, eine Affordanz innerhalb ihrer jeweiligen technischen, diskursiven und gesellschaftlichen Konstellation (Caroline Levine 2015). Digitale ästhetische Formen sind damit immer auch in besonderer Weise epistemische Objekte. So zeigen etwa algorithmisch erzeugte Zufallstexte der Nachkriegszeit nicht nur ein spezifisches Zusammenspiel von Regel und Abweichung in der neu entstehenden Computertechnologie, sondern lassen sich auch dem zeitgenössischen Kreativitätsdiskurs zuordnen, in dem die Produktion des Neuen und Überraschenden an die Stelle älterer Konzepte des schöpferischen Subjekts tritt. In solchen Konstellationen sind die Formen digitaler Literatur ein ums andere Mal mehr als nur Reflexionen medialer Praktiken und diskursiver Verknüpfungen; sie lassen sich ebenso, wenn sie etwa die Abhängigkeiten der KNN-Textproduktion von Datenextraktion und Ressourcenausbeutung sichtbar machen, als ästhetische Werkzeuge der Kritik jener Infrastruktur verstehen, der sie ihre Existenz verdanken.
Der Workshop lädt das Wissen in die digitale Literatur, fragt also nach seinen Ordnungen zwischen Bibliothek und Programm-Library: Wie entsteht Wissen in digitalen Konstellationen, und wo ist es dabei an literarische Formen gebunden? Beiträge können als theoretische Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Wissen und Form in der digitalen Literatur angelegt sein, oder aber als Fallstudien zu ihrer Geschichte und Gegenwart in Form einer medienspezifischen Analyse (Katherine Hayles). Sie können sich der Herausarbeitung besonderer medienhistorischer oder praxeologischer Konstellationen widmen, oder auch Poetologien des Wissens der epistemologischen Beziehung zwischen Literatur und Digital Humanities, Statistik, Mathematik, Informatik und Linguistik. Andere, genuin ästhetische Wissensbestände zwischen Zufall, Planung und Serendipität in einer digitalen Konstellation können in Form von Artistic Research diskutiert werden. Denkbar sind ebenso Interventionen zur Wissensvermittlung durch literarische Formen im Vergleich mit seiner digitalen Visualisierung.
Programm folgt.
In Kürze entsteht hier die erste Ausgabe des Kuratierten Büchertischs...
Mitwirkende
Hier findet Ihr Informationen zu allen Mitwirkenden.
Hannes Bajohr
Hannes Bajohr ist Assistant Professor of German an der University of California, Berkeley.
Produktion literarischer und akademischer Texte.
Arbeitet zu politischer Philosophie, philosophischer Anthropologie, Sprachtheorie des 20. Jahrhunderts, digitalen Literaturen.
Schreibt Prosa, Essayistik und digitale Lyrik.
Zuletzt erschienen Digitale Literatur zur Einführung (2024, mit Simon Roloff), Das Subjekt des Schreibens. Über Große Sprachmodelle
(2024, hg. mit Moritz Hiller) sowie der Roman (Berlin, Miami) (2023).
Hannes Bajohr, Foto: privat Jenifer Becker
Jenifer Becker (*1988) ist eine in Berlin lebende Autorin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin.
Sie schreibt über Ambivalenzen des Digitalen, Gegenwartsphänomene und Popkultur.
Ihr Debütroman Zeiten der Langeweile erschien 2023 bei Hanser Berlin.Sie lehrt seit 2015 am Literaturinstitut Hildesheim, wo sie 2021 promovierte.
In aktuellen künstlerisch-wissenschaftlichen Projekten forscht sie zum Einfluss lernfähiger Technologien (KI) auf Schreibprozesse.

Jenifer Becker, Foto: privat Jenny Bohn
Jenny Bohn studierte Politische Wissenschaften, Soziologie und Neuere Deutsche Literatur in München.
Von 2021 bis 2023 war sie als Dramaturgin für Digitale Formate für Burg Hülshoff - Center for Literature (CfL), den Programmbetrieb der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung, tätig.
Seit 2023 leitet sie am CfL den Bereich Programm.Andreas Bülhoff
Andreas Bülhoff hat über Interfacekonzepte in digitaler und postdigitaler Textkunst promoviert und forscht künstlerisch und wissenschaftlich zu Text und Technologien.
Er ist Mitbegründer der Library of Artistic Print on Demand und verlegt unter sync.ed experimentelle postdigitale Bücher.
Gemeinsam mit Marc Matter führt er das Label für sonic poetry Spoken Matter.
2022 war er Medienkunstfellow des medienwerk.nrw und 2022/23 Hauskünstler an der Burg Hülshoff — Center for Literature. Dort hostet er die Veranstaltungsreihe Tab Talks, bei der Autor*innen per Screenshare Einblicke in ihre Schreibumgebungen und Arbeitsweisen geben.

Andreas Bülhoff, Foto: Aram Bartholl Stephanie Catani
Prof. Dr. Stephanie Catani
CV: seit 2021 Leitung des Lehrstuhls für Neuere deutsche Literaturgeschichte (Universität Würzburg),
2018-2021 Leitung des Lehrstuhls für Neuere deutsche Literaturwissenschaft / Medienwissenschaft (Universität des Saarlandes), zuvor wissenschaftliche Tätigkeiten an den Universitäten Bamberg und Augsburg.Forschungsschwerpunkte: Literatur, Kultur und (digitale) Medien der Gegenwart; Intermedialität (Literatur – Film – Fotografie), generative Literatur und Kunst, Literaturbetrieb und Literaturwissenschaft im Zeichen Künstlicher Intelligenz
Publikationen zum Thema (Auswahl): Generative Literatur. Produktion und Rezeption im Zeichen des Codes. Hg. mit M. Meuer und N. Penke. Textpraxis – Digitales Journal für Philologie, Sonderausgabe 8 (2024); Handbuch Künstliche Intelligenz und die Künste (Hg.). De Gruyter: Berlin 2024; »Art is the only ethical use of AI«. Generative Kunst zwischen Begrenzung und Entgrenzung. In: Grenzen der Künste im digitalen Zeitalter. Hg. von M. Meuer u. a. Berlin/New York: De Gruyter 2025, 53-69; Halluzinierte Autorschaft. "Deepfake Autofictions" mit Großen Sprachmodellen. In: Das Subjekt des Schreibens. Über Große Sprachmodelle. Hg. von H. Bajohr und M. Hiller. Sonderband Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur X/24, 157-169; Mit KI schreiben – über KI schreiben. Künstliche Intelligenz als Thema im literaturwissenschaftlichen Studium. In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes Jg. 70, Heft 4 (2023), S. 393-405.

Stephanie Catani, Foto: privat Jan Distelmeyer
Jan Distelmeyer lehrt Mediengeschichte und -theorie im Kooperationsstudiengang Europäische Medienwissenschaft (EMW) der Fachhochschule Potsdam und Universität Potsdam.
Aktuelle Forschungsschwerpunkte liegen im Verhältnis von Medialität und Digitalität; das besondere Interesse an Interfaces, Arbeitsformen der Plattformisierung von KI und ChatGPT als Beispiel bietet Brücken zum Wissen der digitalen Literatur.
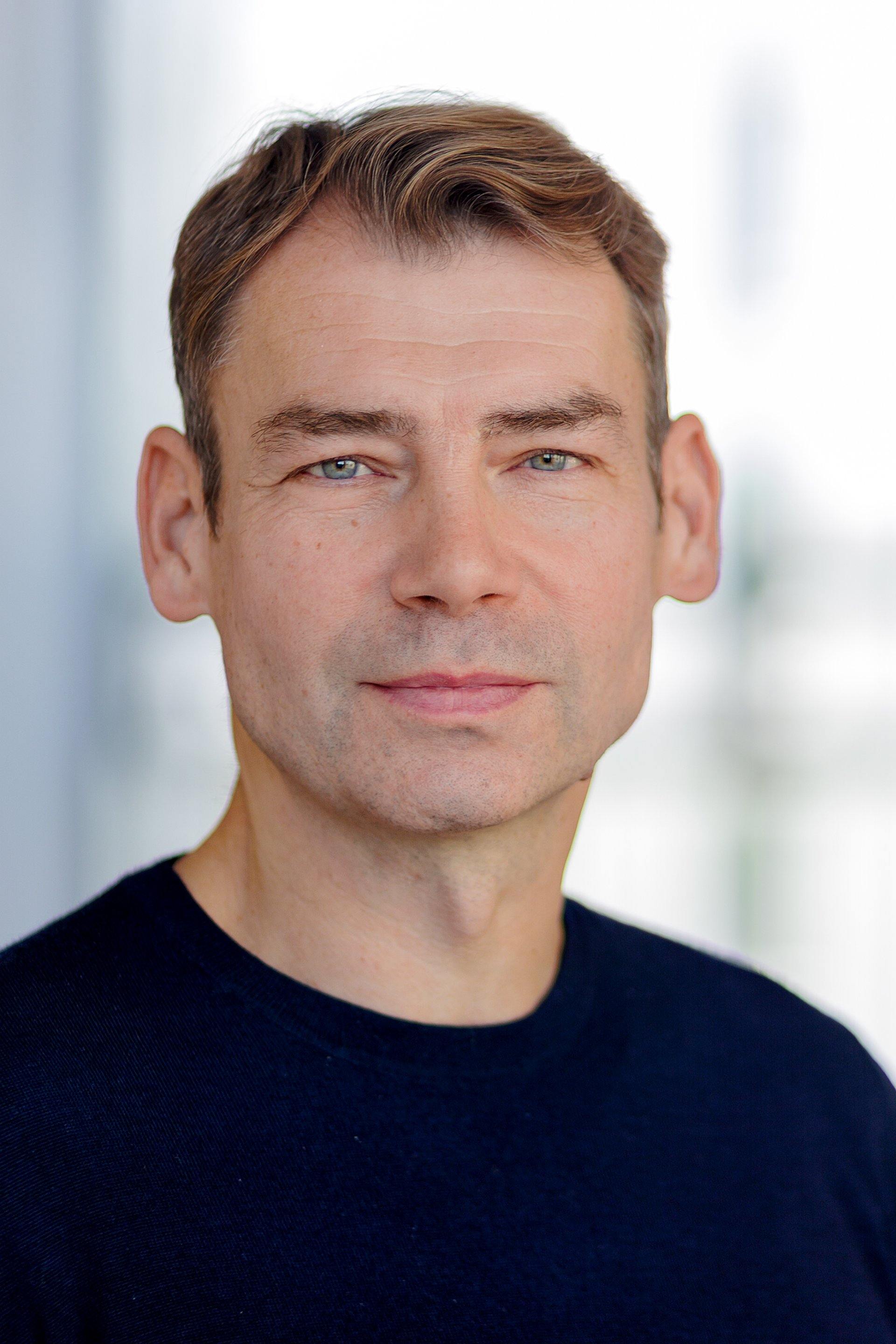
Jan Distelmeyer, Foto: Andrea Hansen Astrid Ensslin
Astrid Ensslin ist Professorin für Dynamiken virtueller Kommunikationsräume an der Universität Regensburg.
Sie forscht seit ihrer Dissertation zur Kanonizität literarischer Hypertexte (Bloomsbury, 2007) an den Überschneidungsbereichen zwischen digitalen Medien, Literatur, Narrativität und Spiel sowie mit Ansätzen der kognitiv-empirischen Leseforschung und des künstlerisch-kritischen Community Co-Design.
Sie ist Direktorin der Electronic Literature Organization und Herausgeberin der Reihe Electronic Literature bei Bloomsbury.

Astrid Ensslin, Foto: privat Annette Gilbert
Annette Gilbert ist Literaturwissenschaftlerin an der FAU Erlangen-Nürnberg mit besonderem Interesse an der Medialität und Materialität von Literatur und an Phänomenen im Grenzbereich von Kunst und Literatur.
Der Schwerpunkt liegt auf der avantgardistischen und experimentellen Literatur und Kunst.
Weitere Forschungsinteressen sind Werk- und Autorschaftskonzepte, Medien- und Kulturtechniken sowie Publikations- und Distributionspraktiken im postdigitalen Zeitalter.
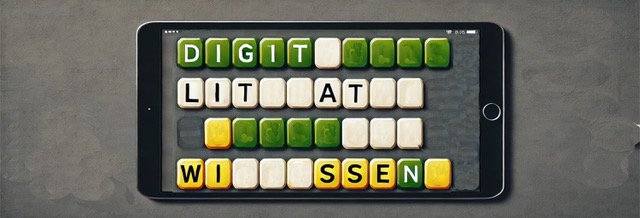
Guido Graf
Guido Graf (Dr.) ist Literaturwissenschaftler und Senior Researcher am Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft an der Universität Hildesheim.
Arbeitsschwerpunkte: Literatur in der Post-Digitalität, Digitale Textpraxis, Soziale Poetik.
Publikationen: Soziale Poetik, Berlin 2026; (Zusammen mit Annette Pehnt) Von Satz zu Satz, Hildesheim/München 2022; Theorien der Literatur, Hildesheim/München 2021; (Hrsg. zusammen mit Ralf Knackstedt und Kristina Petzold) Rezensiv – Online-Rezensionen und Kulturelle Bildung, Bielefeld 2021.

Guido Graf, Foto: privat Mattis Kuhn
Mattis Kuhn arbeitet zur wechselwirkenden Gestaltung von Menschen, Technologien und der gemeinsamen Umwelt. Der Fokus liegt auf textbasierten und textprozessierenden Systemen und der Verflechtung von Kunst, geisteswissenschaftlicher Forschung und Technologien. Er ist Co-Leiter des KI-Labs an der HfG Offenbach.
Texte: As far as I don’t know. Aesthetic Experience as Diffraction Apparatus (2025), AFFIRMATIVE — REJECT. With and Against AI (2024), Grasslands for Insects (2022), Selbstgespräche mit einer KI (2021).

Mattis Kuhn, Foto: Ava Leandra Kleber Franziska Morlok
Franziska Morlok ist Designerin und Professorin für „Grundlagen und Prozesse des Entwerfens“ an der Universität der Künste Berlin.
In ihrem Designstudio Rimini Berlin arbeitet sie mit verschiedenen Auftraggeber*innen aus Kultur und Wissenschaft zusammen.
Ihr Fokus liegt auf (experimentellen) Publikationen in gedruckter, digitaler, räumlicher oder hybrider Form – ein Ansatz, den sie auch in das Netzwerk »Das Wissen der digitalen Literatur« einbringt.

Franziska Morlok, Foto: Louisa Stickelbruck Katharina Nejdl
Katharina Nejdl ist Grafikdesignerin, Developerin und Lehrende.
Sie interessiert sie sich dafür, digitale Technologien – wie Web, AR und AI –als grafische Mittel einzusetzen.
2019 gründete sie mit Sophia Rohwetter, Chris Möller und Victor Kümel das ­ magazine. ­ ist ein online Literaturmagazin, das neue Wege des digitalen Lesens, Schreibens und Publizierens erforscht.

Katharina Nejdl, Foto: Nora Hollstein Simon Roloff
Simon Roloff vertritt aktuell die Professur für Medienästhetik am ICAM der Leuphana Universität Lüneburg.
Arbeitet zu digitaler Literatur, Critical Code und Cricital AI Studies.
Schreibt Prosa, Essayistik und experimentelle digitale Literatur.
Zuletzt erschienen Digitale Literatur zur Einführung (2024, mit Hannes Bajohr), Ausweitung der Coachingzone (2024).

Simon Roloff, Foto: privat Peer Trilcke
Peer Trilcke ist Professor für deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts an der Universität Potsdam, Leiter des Theodor-Fontane-Archivs ebendort und Sprecher des Potsdamer Netzwerks für Digitale Geisteswissenschaften.
Er forscht u.a. zu experimentellen Formen der Gegenwartsliteratur und arbeitet im Feld der Computational Literary Studies an der algorithmischen Analyse literarischer Texte.

Peer Trilcke, Foto: privat Dorothea Walzer
Dorothea Walzer, Dr. Phil.: Seit 2015 Wiss. Mitarbeit Germanistisches Institut Ruhr-Universität Bochum;
Forschungsaufenthalte 2025 Cornell, 2009/2010 Princeton; 2015 Promotion Humboldt-Universität zu Berlin;
Schwerpunkte: Medien der Öffentlichkeit, Selfpublishing, populäre Formen, Interview, feministische Ästhetik, Alexander Kluge, Künstlerische Avantgarden, Digital Literacy;
Aktuell: Banales Publizieren. Praktiken, Verfahren und Episteme des Selfpublishings (Hg. mit E. Linseisen), Lüneburg 2025.
Ausgewählte Publikationen zum Thema: Banales Publizieren. Praktiken, Verfahren und Episteme des Selfpublishings (Hg. mit E. Linseisen), Lüneburg: meson press 2025; Self(ie)-Publishing. Rupi Kaurs Instapoesie als hybrides Publikations-modell, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 142/2, 2023, S. 259–284;
How to Selfpublish in Student Writing? Selbstpublizieren im Theorie- Praxistest, in:Experimente lernen, Techniken tauschen. Ein spekulatives Handbuch no 2, hg. v. Julia Bee, Gerko Egert, nocturne 2024, 1-23; Ubiquitäres Publizieren. Zur Theorie und Geschichte des Selbstveröffentlichens, in: Journal of Literary Theory 17/1 2023, S. 11–37.; Self(ie)-Publishing. Rupi Kaurs Instapoesie als hybrides Publikations-modell, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 142/2, 2023, S. 259–284.
Dorothea Walzer, Foto: privat Tobias Wilke
Tobias Wilke, Prof. Dr., lehrt deutsche Literatur und Medienwissenschaft an der University of North Carolina Chapel Hill und ist Fellow am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin.
Forschungsschwerpunkte: Literatur der europäischen Moderne und Avantgarden, Medientheorie und Mediengeschichte, Theorien des Digitalen, Sound Studies, Literatur und Wissenschaftsgeschichte.
Zur Zeit Abschluss eines Buchprojekts mit dem Titel Lautbilder und Maschinenschrift: Modelle digitaler Sprachlichkeit im 20. Jahrhundert.

Tobias Wilke, Foto: privat
Das Netzwerk startete im Dezember 2024 und läuft 3 Jahre. Es wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.